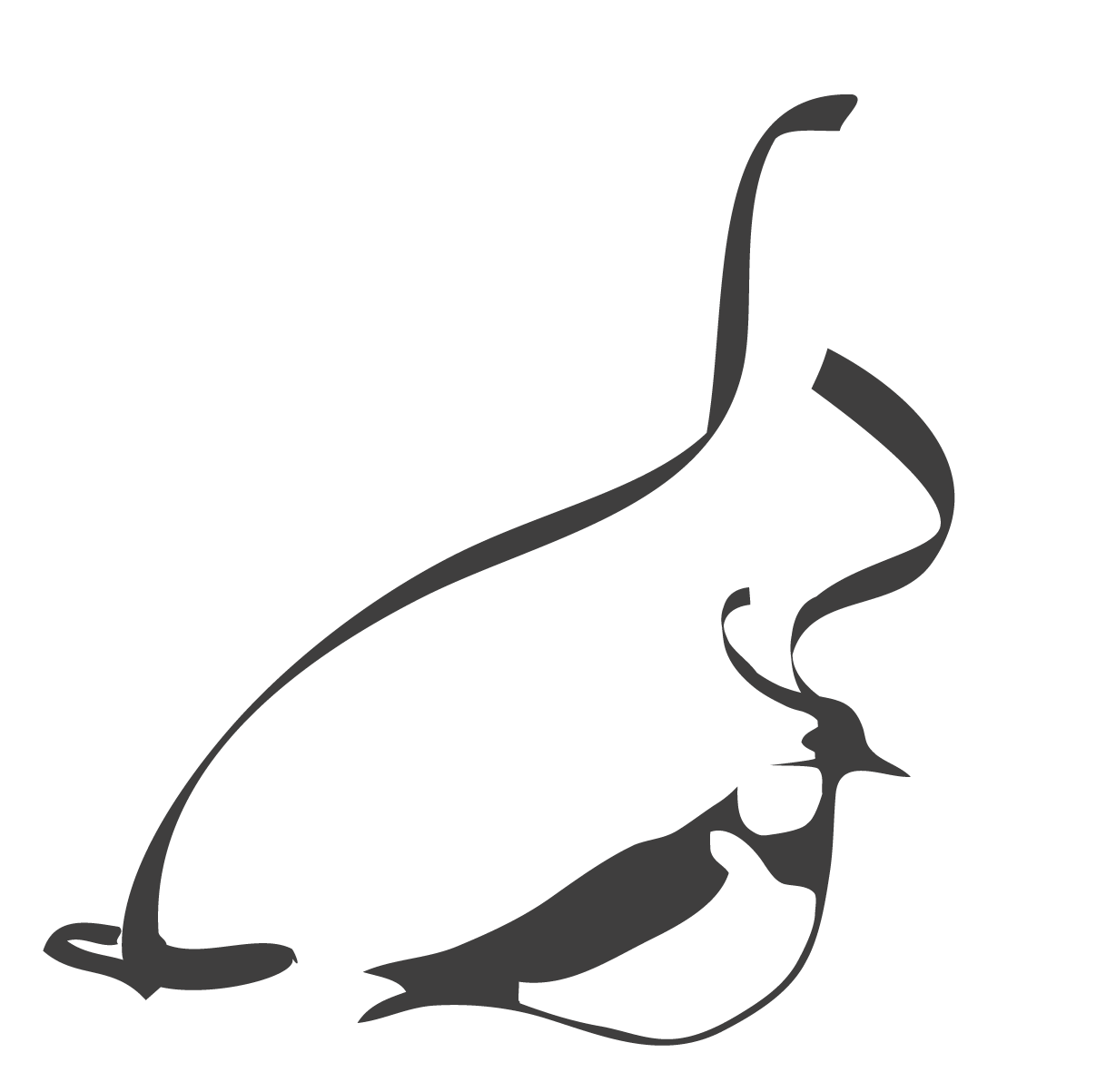Der Rückgang des Rebhuhns begründet sich in verschiedenen Ursachen. Durch die Kombination der verschiedenen Gründe verstärkt sich die Wirkung der einzelnen Faktoren.
Wetter
Die Witterung im Brut- und Aufzuchtszeitraum spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Populationsdichte.
Kalte und nasse Junimonate könnten 2008 eine Ursache für den starken Rückgang in Nordzentralfrankreich darstellen. So halbierte sich der Brutbesatz im Folgejahr um 50 % (Bro und Millot 2013). Auch in Polen wird ein Einfluss der Witterung auf den Bruterfolg nicht ausgeschlossen. Jedoch lösen die Witterungsbedingungen nur eine jährliche Fluktuation aus (Panek 2005).
In den stabilen Rebhuhnpopulation bis 1950 bestimmten überwiegend die Witterungsbedingungen die Kükensterblichkeit (Kuijper et al. 2009). Bei extremen Winterereignissen kann es immer wieder zu Einbrüchen der Rebhuhnpopulation geben. So sind Rebhühner bei längerer Schneelage einem erhöhten Prädationsrisiko ausgesetzt. Durch zwei schnee-reiche Winter im Göttinger Rebhuhnschutzprojekt gab es solche Einbrüche (Gottschalk und Beeke 2014). In den letzten Jahren gab es fast keine Schneetage im Untersuchungs-gebiet aufgrund der sehr milden Winter und der klimatisch begünstigen Lage in der Rheinaue. Daher ist zumindest in den Wintermonaten mit keinen starken Einbrüchen der Population durch Schnee auszugehen.
Landwirtschaftliche Nutzung und Agrarpolitik
Im Rahmen einer Telemetriestudie in Frankreich war die Verlustursache der besenderten Rebhuhnhennen durch die landwirtschaftliche Nutzung gering. Sie betrug in den Jahren 2010 und 2011 (201 untersuchten Hennen) sowie 1995 bis 1997 (407 untersuchten Hen-nen) jeweils 5 %. Die Verluste traten durch Maschineneinsatz im Wintergetreide, Erbsen, Luzerne und Grünland ein. Die Gelegeverluste durch landwirtschaftlichen Maschinenein-satz ist dagegen deutlich höher. Dieser betrugen 2010-2011 9 % der untersuchten Nester (55 Stück) und im Zeitraum von 1995 bis 1997 20 % (120 Nester).
Der Ausfall der Nachgelege ist deutlich höher. Dieser beträgt von 2010 bis 2011 36 % (42 untersuchte Nester) und 41 % im Zeitraum von 1995-1997 (79 untersuchte Nester). Die höheren Verlustraten der Nachgelege begründen sich durch den späteren Schlupf und die einhergehende Getreideernte. Die Erstgelege werden insbesondere durch die Grünland- und Luzernemahd Mitte Mai bis Anfang Juli zerstört. Durch die klimatischen Schwankun-gen in den einzelnen Jahren, können sich die Verluste verschieben bzw. auch begünsti-gend auswirken (Bro und Millot 2013).
1950 bis 1970 gab es einen starken Rückgang der Rebhuhnpopulation durch den vermehr-ten Einsatz von Insektiziden und Herbiziden, wodurch die Kükensterblichkeit durch schlechtere Nahrungsgrundlagen stark anstieg. Zusätzlich fand in dieser Zeit eine starke Zusammenlegung von Ackerschlägen und die Technisierung der Landwirtschaft, verbun-den mit einem Verlust von Feldrändern, Hecken und Brachland statt, welche wichtige Brutplätze der Art darstellten (Kuijper et al. 2009).
Die verstärkte Anwendung von Pestiziden auf Ackerflächen und Obstplantagen wird auch in Westpolen als ein Grund für den Rückgang der Art gesehen (Panek 2005).
Im Rahmen der EU-Agrarpolitik konnten seit 1992 5 bis 15 % Flächenstilllegungen in UK erreicht werden, wodurch zahlreiche Bruthabitate, Winterdeckung sowie Sommer- und Winternahrungsquellen geschaffen werden konnten. Die Flächenstilllegungen wurden aber im Rahmen der Agrarpolitik 2007 / 2008 eingestellt, einhergehend mit rückläufigen Reb-huhnbesätzen (Aebischer und Ewald 2010). Der Wegfall der Brachen aus der EU-Flächenstilllegung und die starke Zunahme des Maisanabaus werden auch in Deutschland als einer der Gründe des starken Rückgangs des Rebhuhns seit diesem Zeitpunkt gese-hen (Hoffmann 2013; Gedeon et al. 2015).
Bei der Ermittlung der Biomasse von flugaktiven Insekten konnten in einem Naturschutz-gebiet in NRW in den 1989 und 2013 ein Rückgang von > 75 % verzeichnet werden, wodurch auch Auswirkungen in Gebiete zu verzeichnen sind, in denen ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht erlaubt ist (Sorg 2013).

Prädation
Es hat sich gezeigt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von Rebhühnern in stark strukturierten Habitaten geringer ist. Der Einfluss von Greifvögeln ist in großen Ackerschlägen und bei einer geringen Variabilität von Anbaufrüchten größer. In einer dauerhaften, flächigen Deckungsstruktur ist das Prädationsrisiko geringer als in linearen Strukturen. Insbesondere in diesen Strukturen ist die Prädationsgefahr durch den Fuchs erhöht. Auch durch die Nähe von Gehölzen erhöht sich das Risiko der Prädation durch Marderartige wie bspw. den Steinmarder. Füchse nutzen auch vermehrt Grünland zur Nahrungssuche. Hierbei beginnt die Aktivität nicht an den Rändern des Grünlandes, sondern an den jeweiligen Ecken (Bro et al. 2008).
Zusätzlich zu der Intensivierung der Landwirtschaft wird die Zunahme der Prädation und der daraus resultierenden erhöhten Kükensterblichkeit ab den 1970er als Grund für den Rückgang der Art gesehen (Kuijper et al. 2009).
Im Rahmen von zwei Telemetriestudien in Frankreich wurden von 1995 bis 1997 und in den Jahren 2010 und 2011 die Todesursachen im Frühjahr bei Rebhennen bestimmt (Bro und Millot 2013).
| Todesursache | 1995 – 1997 (407 besenderte Hennen) |
2010, 2011 (201 besenderte Hennen) |
| Prädation | 73 % | 78 % |
| Landwirtschaftliche Praktiken | 5 % | 5 % |
| Krankheiten | 5 % | 8 % |
| Kollision mit Fahrzeugen | 5 % | 2 % |
| andere Ursachen | – | 1 % |
| unbestimmt | 12 % | 5 % |
Es wurden auch der Einfluss der verschiedenen Prädatoren in Frankreich untersucht:
| Prädator | 1995 – 1997 (299 besenderte Hennen) |
2010 – 2011 (157 besenderte Hennen) |
| Fuchs | 28 % | 41 % |
| Marderartige | 12 % | 6 % |
| Katzen | 4 % | 5 % |
| Raubsäuger unbestimmt | 18 % | 11 % |
| Greifvögel | 31 % | 20 % |
| Räuber nicht bestimmt | 7 % | 17 % |
Als Hauptursache für den starken Rückgang des Rebhuhnbesatzes in Westpolen ab Mitte der 1990er Jahre wird die Prädation der Gelege und Bruthennen, insbesondere durch den Rotfuchs genannt. Die Rotfuchspopulation hat sich Anfang der 1990er Jahre bis 2004 in Westpolen um den Faktor 3,6 vergrößert. Eine Zunahme weiterer Prädatoren wie Marderhunde und Marderartige ist ebenfalls anzunehmen, da ihr Anteil an der Jagdstrecke stark gestiegen ist. Es wird daher von Panek (2005) empfohlen zunächst die Anzahl der Prädatoren, schwerpunktmäßig den Rotfuchs, zur Brutzeit zu reduzieren.
Auch im Göttinger Rebhuhnschutzprojekt stellt die Prädation bei der Rebhenne mit 50 % die höchste Verlustrate dar. In den meisten Fällen, in denen eine Zuordnung des Prädators möglich war, war der Fuchs verantwortlich (Hoffmann 2013).
Es stellt sich dar, dass die Prädation ein wichtiger Faktor bei der Kükensterblichkeit ist. Je nach Region unterscheidet sich der Anteil der jeweiligen Prädatoren an der Sterblichkeitsrate. Es ist daher davon auszugehen, dass die Prädation bei den Rebhennen von der lokalen Dichte einiger Prädatoren und auch von der Ausstattung und Struktur des Biotops abhängig ist.